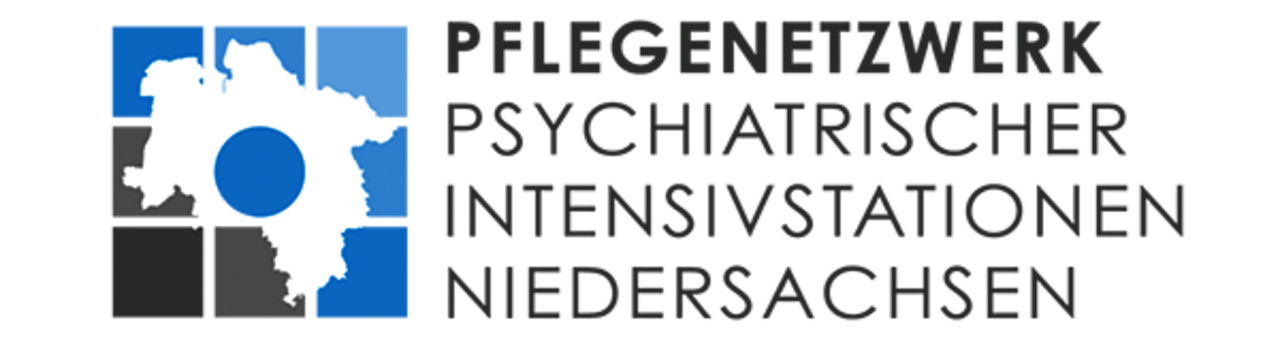Wie der Klimawandel auf die Psyche schlägt
Begriffe wie „Solastalgie“ und „eco distress“ hört man inzwischen häufiger, sie kommen auch in der Berliner Erklärung vor. Was verbirgt sich dahinter, und wie ernst sind diese Phänomene aus therapeutischer Sicht zu nehmen?
Hurlemann: Das sind Wortneuprägungen. Eco distress, oft auch eco anxiety genannt, beschreibt das belastende Gefühl, in Zeiten des Klimawandels und vor dem Hintergrund zunehmender Umweltprobleme zu leben und diesen ohnmächtig gegenüber zu stehen. Ich würde nicht davon sprechen, dass eco distress per se eine Störung ist, sondern eher ein verstärktes Bewusstsein beschreibt, das aber wiederum Vorbote eines Störungsbildes sein kann. Wenn ich vor dem Hintergrund der veränderten Umweltbedingungen starke Gefühle von Angst, Wut und Hilflosigkeit entwickle, habe ich auch ein höheres Risiko für Stress-induzierte psychische Krankheiten wie Angststörungen.
Marsh: Den emotionalen Schmerz, den wir mit „Solastalgie“ benennen, können Betroffene oft nicht eindeutig zuordnen. Sie beschreiben es als eine Art von Heimweh, obwohl sie ihre Heimat womöglich nie verlassen haben. Davon betroffen sind Menschen, die ihren eigenen Lebensraum durch Umweltkatastrophen zerstört sehen. Wenn man zum Beispiel ins Ahrtal schaut, wo viele Menschen durch Überschwemmungen ihr Zuhause verloren haben, können Ereignisse wie dieses zu Solastalgie führen.
Umwelteinflüsse können aber auch noch viel unmittelbarer Einfluss auf die psychische Gesundheit nehmen. Welche Zusammenhänge gibt es?
Hurlemann: Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass die Zahl der Menschen, die an Depressionen erkranken, mit der Feinstaubbelastung steigt. Diese Beobachtung ist für Luftverschmutzung besonders gut herausgearbeitet worden. Es könnte aber sein, dass auch andere Umweltgifte Einfluss auf die psychische Gesundheit nehmen.
Besonders betroffen von Umweltverschmutzung sind Menschen in Städten. Dass urbane Lebensräume größere Risiken für psychische Erkrankungen bergen, ist längst bekannt. So haben Menschen, die in Städten aufwachsen, zum Beispiel ein höheres Risiko, eine Schizophrenie zu entwickeln. Das Leben dort ist von geringerem sozialen Halt, höherem ökonomischen Druck sowie stärkerer Vereinzelung und Vereinsamung gekennzeichnet – aber eben auch von ungünstigen Umweltbedingungen.
Marsh: Außerdem haben Umwelteinflüsse grundsätzlich eine Wirkung auf kognitive Funktionen wie etwa Gedächtnisleistungen. Das betrifft nicht nur Menschen mit psychischen Krankheiten, wirkt sich bei diesen aber aufgrund ihrer Vorbelastung besonders ungünstig aus.
Hitze ist laut „Berliner Erklärung“ für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen besonders gefährlich und kann sogar zum Tod führen. Wie hängt das zusammen?
Hurlemann: Dabei kommen ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Zum einen registrieren wir bei hohen Temperaturen verstärkt Verhaltensauffälligkeiten aggressiver oder impulsiver Art, zum Beispiel riskantes Autofahren, das zu einem tödlichen Unfall führen kann. Dem von der Hitze ausgelösten Stress begegnen Menschen mit Suchtproblemen damit, dass sie verstärkt konsumieren. Das birgt die Gefahr von Überdosierungen. Außerdem lassen, wie bereits erwähnt, kognitive Fähigkeiten nach, wenn Hitze vorherrscht. Das führt dazu, dass zum Beispiel ältere Menschen mit klassischer Alzheimerdemenz noch weniger trinken. Die Folgen: eine Elektrolytverschiebung, die dazu führt, dass Betroffene das Bewusstsein verlieren oder im schlimmsten Fall verdursten.
Außerdem warnen Sie mit der Erklärung vor indirekten Folgen des Klimawandels. Was meinen Sie damit?
Hurlemann: Vor allen Dingen gehören dazu die Aspekte Nahrung und Trinkwasser. Ist beides in einer Region nicht mehr ausreichend vorhanden, kommt es verstärkt zu Flucht und Migration mit den entsprechenden psychischen Folgen für Betroffene. Wer gezwungen ist, seine Familie oder Heimat unfreiwillig zu verlassen, hat ein erhöhtes Risiko, an Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen zu erkranken.
Auch Menschen ohne Fluchterfahrung werden von indirekten Folgen des Klimawandels betroffen sein. Ich denke da zum Beispiel an die Landwirtschaft in Niedersachsen. Ihr stehen große Transformationsprozesse bevor, etwa die Umstellung von konventioneller auf klimafreundliche Tierhaltung. Die Elektromobilität sorgt für Veränderungen in der hier starken Automobilbranche. Solche Prozesse bergen immer die Gefahr, dass Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren und in persönliche wirtschaftliche Not geraten. Und wem es finanziell nicht gut geht, der leidet in globalen Krisen auch verstärkt unter psychischen Krankheiten, das haben Untersuchungen in der Covid-19-Pandemie gezeigt.
Die Task-Force empfiehlt, den Fokus insbesondere auf Prävention zu legen. Wie können wir die „psychische Fitness“ erlangen, die wir brauchen, um mit den bevorstehenden Klimaveränderungen und ihren Folgen umgehen zu können?
Hurlemann: Ein zentraler Aspekt ist, die Resilienz zu steigern, also die Fähigkeit, gut durch schwierige Lebenssituationen zu kommen. Dazu gehört, dass wir die Menschen darüber aufklären, dass ein Zusammenhang zwischen Umweltbedingungen und psychischer Gesundheit besteht. Das ist auch ein Grund, warum wir die Berliner Erklärung veröffentlicht haben.
Außerdem gibt es eine Reihe weiterer Präventionsstrategien, die gefördert werden müssen. Eine davon zielt zum Beispiel auf Empowerment und Ownership. Das bedeutet, dass Menschen so viel Gesundheitskompetenz erlangen, dass sie eigenverantwortlich für sich sorgen können. Dazu gehört auch, bereits frühzeitig psychologische Hilfe aufzusuchen. Dafür müssen niederschwellige Angebote zur Verfügung stehen.
Marsh: Prävention heißt aber auch, dass wir als Gesellschaft besonders auf die Menschen achten, die das größte Risiko haben, von den Folgen des Klimawandels betroffen zu sein und kaum Optionen haben, sich effektiv davor zu schützen: Obdachlose, die auf der Straße leben, ältere gebrechliche Menschen, oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auf Unterstützung durch andere angewiesen sind.
Die Berliner Erklärung richtet sich außerdem an psychiatrische und therapeutische Einrichtungen und gibt Empfehlungen für klimabewusstes Handeln im Berufsalltag. Warum verquicken Sie beide Bereiche?
Marsh: Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir selbst uns bei dieser großen Herausforderung als Fachdisziplin ausnehmen. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in Krankenhäusern unter dem Stichwort „green hospital“ betrifft auch psychiatrische Kliniken. Wichtig ist es, das Bewusstsein der Akteurinnen und Akteure zu schärfen und das Thema Klimaschutz im Arbeitsalltag präsenter zu machen.
Eine Nachhaltigkeitsstrategie sollte ambitionierte Ziele beinhalten, sich gleichzeitig aber auch über die Grenzen des Klimaschutzes für den jeweiligen Sektor im Klaren sein. Eine Klinik wird zum Beispiel aufgrund von Hygiene-Standards immer einen bestimmten Anteil an Verpackungsmüll produzieren, der sich nicht vollständig vermeiden lässt. Nur wenn Klimaziele und -maßnahmen eindeutig definiert sind, können sich alle Beteiligten auf diejenigen Bereiche konzentrieren, wo Veränderungen tatsächlich möglich sind, sodass Klimaschutz und Nachhaltigkeit mehr als nur PR-Phrasen ist.
(Interview: Sonja Niemann, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)